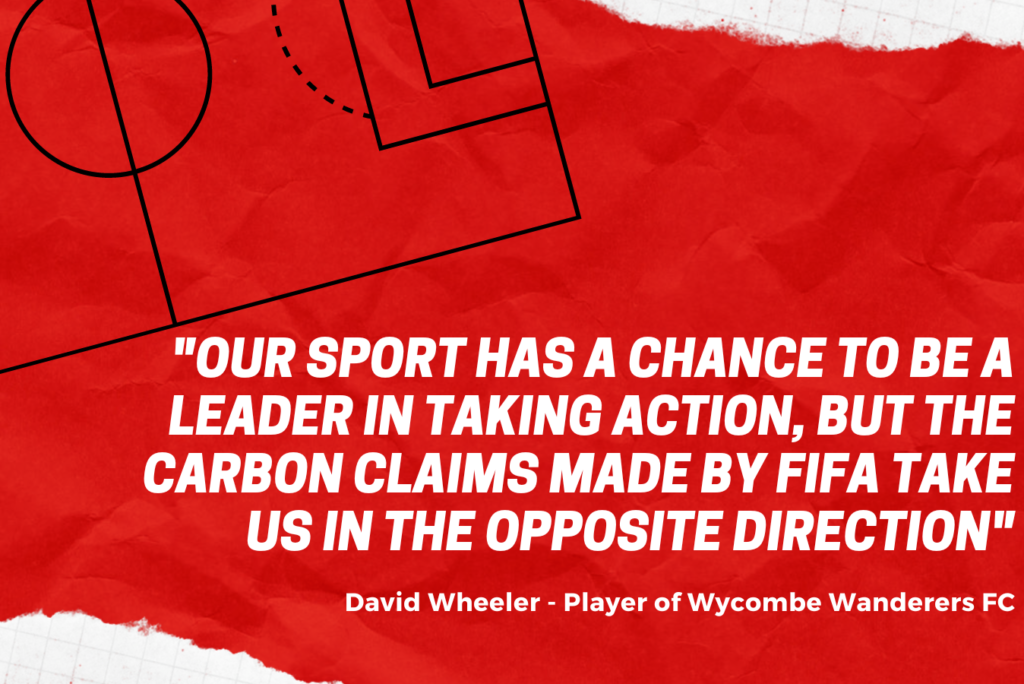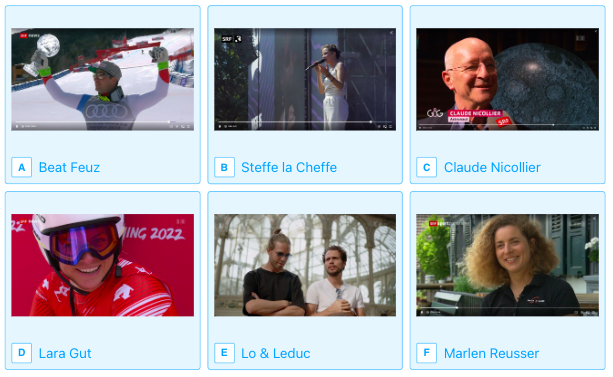Klimakosten lassen sich nicht wegzaubern
Die Schweiz will ihren viel zu grossen Pro-Kopf-Klimafussabdruck im Ausland kompensieren. Das ist moralisch fragwürdig, ökonomisch kurzsichtig und zur Lösung der Klimakrise so wenig nachhaltig wie die propagierte grossflächige Aufforstung im Süden.
Die Fakten sind klar: In seinem Sonderbericht vom Herbst 2018 legte der Weltklimarat IPCC dar, dass ein Überschiessen der globalen Erhitzung um mehr als 1.5° Celsius nur verhindert werden kann, wenn weltweit noch höchstens 420 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente (CO2eq) in die Atmosphäre gelangen. Wenn dieses «Restbudget» ausgeschöpft ist, muss jede zusätzlich ausgestossene Tonne CO2eq der Atmosphäre wieder entzogen werden. Rein rechnerisch müssten die Emissionen gegenüber heute jedes Jahr um netto 5% abnehmen. Damit könnte der globale Treibhausgas-Ausstoss bis 2030 auf die Hälfte, bis 2040 auf «netto null» abgesenkt werden.
Im August 2019 reihte sich die Schweiz unter jenen Ländern ein, die ihren Treibhausgas-Ausstoss auf «netto null» senken wollen. Bis spätestens 2050 sollen demnach unter dem Strich keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre gelangen. Mit welchen Massnahmen die Schweiz klimaneutral werden soll, insbesondere wie sie etwa nicht reduzierbare Emissionen aus der Landwirtschaft kompensieren will, liess der Bundesrat offen. Stattdessen setzt er weiterhin auf CO₂-Kompensation im Ausland. Sollte das Parlament diesen Kurs weiterhin stützen, würde die Schweiz auf eine Reihe von groben hausgemachten Problemen zusteuern.
Völkerrechtlich ist bis heute unklar, wie grenzüberschreitende Kompensationsprojekte ab Inkrafttreten des Pariser Klimaübereinkommens 2021 geregelt werden sollen. Zwar sieht das Abkommen in Artikel 6 die Möglichkeit vor, dass Vertragsstaaten ihre erzielten Emissionsreduktionen über Zertifikate untereinander austauschen respektive handeln können. Die Details, wie die sogenannten Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO) zustande kommen und korrekt abgerechnet werden sollen, sind Gegenstand des letzten noch nicht verabschiedeten Kapitels im Pariser Regelbuch. Dort muss sichergestellt werden, dass jede gehandelte Tonne tatsächlich einer aus Sicht der Atmosphäre reduzierten Tonne CO2eq entspricht und auch nicht doppelt, einmal im Käufer- und einmal im Verkäuferland, angerechnet werden kann.
Ökonomischer Trugschluss
Die angepeilte Halbierung der Schweizer Inlandemissionen bis 2030 soll gemäss Bundesrat und Parlament nur zu drei Fünfteln durch Reduktionsmassnahmen im Inland erzielt werden. Den Rest will die Schweiz, übrigens als eines von ganz wenigen reichen Ländern, über den Zukauf von ITMOs «kompensieren». Dementsprechend setzt sich die Schweiz an vorderster Front ein für einen baldigen Abschluss der Kompensationsregelung im Pariser Klimaübereinkommen.
Auf den ersten Blick ist es verlockend, Emissionen im Ausland zu kompensieren, denn vorläufig ist das noch günstiger. Auf den zweiten Blick drängt sich jedoch die Frage auf, wieso jährlich steigende Mittel für den Zukauf ausländischer Emissionsreduktionszertifikate eingesetzt werden sollen, statt mit diesen Millionen die Umstellung der inländischen Infrastruktur auf emissionsfreie Technologien voranzutreiben. Es ist simple Logik, dass die Auslagerungsstrategie über kurz oder lang scheitern muss: Weil alle Länder ihre Emissionen auf netto null reduzieren müssen, werden ausländische Emissionszertifikate schnell zur Mangelware. Nachdem die low-hanging fruits geerntet sind wird bald kein Land mehr bereit sein, seine mit zunehmendem Aufwand erzielten Fortschritte Richtung Klimaneutralität günstig abzugeben. Die Schweiz wird also nicht darum herumkommen, ihre eigenen Emissionen doch auch zu eliminieren; und zwar unabhängig davon, ob wir zuvor Reduktionen im Ausland bezahlt haben oder nicht.
«Negativemissionen» und Aufforstung
Möglich bleibt, nicht reduzierte Treibhausgasemissionen mittels sog. «Negativemissionen» zu kompensieren; also überschüssige Treibhausgase (v.a. CO2) aus der Atmosphäre einzufangen und langfristig wieder im Boden oder in Biomasse einzulagern. Dafür werden bereits hochtechnische Ansätze getestet, deren Praktikabilität, Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit jedoch erst noch geklärt werden müssen. Zukunftsweisender scheint dagegen der Weg über die Produktion von Pflanzenkohle als Nebenprodukt aus der Energiegewinnung aus Holz oder Biomasseabfällen. Denn Pflanzenkohle lässt sich mit nachweislich positiven Effekten über Jahrzehnte in landwirtschaftliche Böden einarbeiten.
Im Zentrum der Debatte stehen die «grünen» Ansätze zur CO2-Einlagerung in Biomasse oder Böden. Das reicht von der (Wieder-)Aufforstung abgeholzter Wälder bis zur Anreicherung von CO2 in Form von Humus in landwirtschaftlichen Böden. Meistens unkritisch wird die Aufforstung als ein zentraler Lösungsansatz der Klimakrise gepriesen. Während sich selbst die Fachwelt noch uneinig ist, wie gross das Absorptionspotential von neu aufgeforsteten Wäldern unter dem Strich tatsächlich ist, gilt es auch entwicklungspolitische Einwände zu berücksichtigen.
So stellt sich schon aus moralischer Sicht die Frage, mit welcher Rechtfertigung reiche Länder mit einem weit überdurchschnittlichen Pro-Kopf-Klimafussabdruck Entwicklungsländer als Ausweichstandort für versäumte eigene Klimamassnahmen ins Visier nehmen. Es kann nicht sein, dass wir nicht bereit sind, unseren Lebensstil ernsthaft zu überdenken und gleichzeitig fordern, dass die dadurch verursachten Emissionen fernab von zuhause eingespart werden sollen. Ganz zu schweigen von komplexen Fragen wie jener, wo genau denn in grossem Stil überhaupt neue Wälder angepflanzt werden sollen. Wie kann die Vertreibung von Menschen zwecks Weideraufforstung gerechtfertigt sein, selbst wenn deren mittlerweile landwirtschaftlich genutzten Böden ursprünglich einmal Waldflächen waren? Es ist klar: Gerade «grüne» Klimaprojekte müssen den Nachhaltigkeitskriterien der Agenda 2030 standhalten; die Einhaltung demokratischer Mitsprache und der Menschenrechte der betroffenen Bevölkerungen muss gewährleistet sein.
Jürg Staudenmann, Alliance Sud